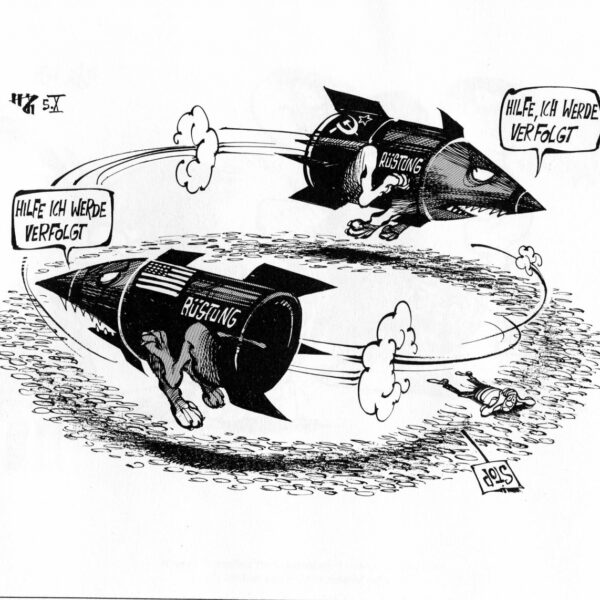Mangelnder Wohlstand
Die verbaute Zukunft für die eigenen Kinder -Wohl-Stand verwehrt!
Geht es um das Wohl der Kinder? Erziehung und Bildung in der DDR
Für Eltern ist das Wohl ihrer Kinder ein wichtiger Faktor, um sich selbst in einer Gesellschaft wohlzufühlen. Den Kindern soll es gut gehen, ihre Zukunft soll gesichert sein, es soll ihnen nichts Schlechtes geschehen.
Vom Lebensanfang an sorgte die DDR für eine staatlich finanzierte „Vollversorgung“ für Kinder. Kostenfreie Kindertagesstätten und Kindergärten ermöglichten es beiden Elternteilen zu arbeiten. Nach Beendigung der Schullaufbahn hatten alle Jugendlichen das Recht auf eine Berufsausbildung und später auf einen Arbeitsplatz. Das Erziehungs- und Bildungssystem der DDR wird darum oft als vorbildlich bezeichnet. Übersehen wird dabei aber, dass hinter den Maßnahmen ein Konzept stand, das für jede Diktatur gilt: der Versuch, durch Bildungs- und Erziehungsmaßnahmen die nächsten Generationen bestmöglich zu kontrollieren.
Historischer Kontext
Auch wenn der Begriff „Sozialismus“ dazu verleitet an soziale Unterstützung durch den Staat zu denken, spielten bei der Vollversorgung der Kinder in der DDR auch wirtschaftliche Erwägungen eine Rolle. Die Verantwortlichen hatten immer Schwierigkeiten den Bedarf an Arbeitskräften zu decken. Außerdem sah das sozialistische Wirtschaftssystem vor, dass alle Bürger*innen arbeiten sollten. Die Frauen mussten dafür gesellschaftlich freigemacht werden, indem ihnen die Kinderbetreuung während der Arbeitszeiten abgenommen wurde. Es spielten also auch pragmatische Überlegungen eine Rolle bei der Gestaltung des Erziehungssystems in der DDR.
Gleichzeitig gewann der Staat so schon sehr früh die Gelegenheit die Kinder auf das Leben im Sozialismus vorzubereiten. Dazu gehörte die entsprechende Erziehung zu denken und zu leben wie der Staat es für richtig befand. Die Idee dabei war es Bürger*innen von morgen zu formen, die dem System und der Regierung in der DDR ergeben und folgsam sein sollten.
Konnten Eltern damit leben, hatte man ein gutes Auskommen mit dieser Form der frühen ideologischen Beeinflussung. Wer keine anderen politischen Vorstellungen hatte und sich im System der DDR wohlfühlte wurde versorgt und unterstützt. Für andere ergaben sich daraus aber Gefahren für die Zukunft der eigenen Kinder. Wer seine Kinder zu frei denkenden Menschen erziehen wollte, musste zwangsläufig mit dieser Form der staatlichen Erziehung in Konflikt geraten.
Eltern wollen ihre Kinder in der Regel beschützen. Dabei sind zwar nicht alle Gefährdungen berechenbar, aber manche stehen deutlich im Raum und werfen ihre Schatten voraus. So sahen das auch Eltern in der DDR, die mit dem System nicht einverstanden waren. Die Gesellschaft selbst, die geforderte sozialistische Lebensweise, die Erziehung zu einer Sozialistischen Persönlichkeit waren die Gefahren, vor denen Eltern ihre Kinder schützen wollten. Kinder brachten Ideen mit nach Hause, die den Eltern vor den Kopf stießen. Wem die politische Agitation in der Öffentlichkeit gegen den Strich ging, musste umso geschockter sein, dieselben Phrasen aus dem Mund des eigenen Kindes zu hören. Kreative Lösungen waren gefragt, wollte man nicht offen mit dem Staat in Konflikt treten.
Transparenz
Dieses Kapitel setzt sich mit einem Thema auseinander, das erstaunlicherweise nicht nur von Menschen mit DDR-Erfahrung, sondern auch von vielen Menschen mit geringen Kenntnissen zur DDR als „vorbildlich“ angesehen wird, und zwar mit der staatlichen Vollversorgung für Kinder. Im vorliegenden Kapitel wird nicht über Gründe dieser Eischätzungen spekuliert (man könnte ein „heißes Thema“ dahinter vermuten, nämlich die mangelnde Zahl an Betreuungsplätzen heute). Vielmehr geht es uns darum, auf Hintergründe und Zusammenhänge zu verweisen, die bei der unreflektiert positiven Einschätzung des Erziehungs- und Bildungssystems übersehen werden.
Geht es um das Wohl der Kinder? Erziehung und Bildung in der DDR
Diese Sektion ist als Kapiteleinführung zu verstehen. Es verweist insbesondere darauf, dass – wie es für eine Dikatur typisch ist – in der DDR nicht nur beabsichtigt wurde, durch Bildungs- und Erziehungsmaßnahmen die nächsten Generationen für sich zu gewinnen, sondern auch diese bestmöglich zu kontrollieren. Hinzu kam der Arbeitskräftemangel in der DDR, der nicht zuletzt Folge der Fluchtbewegungen war: die Arbeitskraft der Frauen war dringend notwendig. Ideologisch betrachtet war das Ziel der Berufstätigkeit aller eine Konsequenzen aus Sozialismus und Planwirtschaft und dem dort propagierten „Recht und Pflicht auf Arbeit“.
Diese Zusammenhänge werden insbesondere auch durch die Materialspalte geklärt.
- Das Kindergarten-Foto mit seiner „privaten“, aber ideologielastigen Bildunterschrift wird mit dem Bildungs- und Erziehungsplan für den Kindergarten und den Erinnerungen einer Erzieherin kontextualisiert.
- Zwei Expertentexte sorgen für weitere Einordnungen: Anna Kaminsky (u.a. Autorin eines Bandes zur DDR Frauengeschichte) und Ulrich Mählert (u.a. Autor eines Bandes zur DDR Kindheitsgeschichte).
Vollversorgung der Kinder – Alles gut?
Nicht alle Eltern waren glücklich mit dieser Vollversorgung durch den Staat. Es belastete sie, dass in den Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen das Ziel der Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit über die individuelle Entwicklung des einzelnen Kindes gesetzt wurde.
Sie litten unter den langen täglichen Trennungszeiten von ihren Kindern und dem abendlichen Stress in der eigenen Familie, der nicht zuletzt Konsequenz der Doppelbelastung, insbesondere bei den Frauen, durch Familie und Beruf war. Es schmerzte sie, dass das Recht auf eine Berufsausbildung oft nicht mit der Freiheit der Berufswahl einherging. Vorgaben der Planwirtschaft schränkten die Freiheit der Berufswahl ebenso ein wie eine mangelnde sozialistische Gesinnung in der Familie, die zu Konflikten mit Entscheider*innen führen konnten.
Historischer Kontext
Aber nicht nur die politische Agitation war eine Gefahr, die Eltern Angst machte. Im Blick auf ihre Kinder sahen einige Eltern sich mit der Selbstverständlichkeit konfrontiert, mit der ihre Kinder sich in das System der SED-Diktatur einordneten und z.B. auch an Aktivitäten der Jugendorganisationen teilnehmen wollten. Andere waren mit den Konsequenzen konfrontiert, die sich aus ihrem eigenen Nicht-Angepasstsein oder dem ihrer Kinder für deren schulische Karrieren ergaben. Wieder andere mussten ertragen, dass ihre Kinder Repressalien ausgesetzt waren, weil sie opponiert hatten. Kinder die nicht auf der Linie des Staates mitmachten, wurden ganz offiziell durch die zuständigen Erziehungsbehörden drangsaliert und gemobbt. Druck und Angst sollten diejenigen auf Spur bringen, bei denen das lockende Zuckerbrot nicht gewirkt hatte.
Dabei sind Kinder in erster Linie Kinder und oft nicht in der Lage die Reichweite ihrer Handlungen einzuschätzen. Im Rahmen eines strengen Systems, das dazu angelegt war Verfehlungen zu dokumentieren und noch Jahre später gegen die Betreffenden zu verwenden konnte das ein Problem sein. Die Schwierigkeit für kritisch denkende Eltern war, den eigenen Nachwuchs einerseits selbst zum kritischen Denken zu erziehen und gleichzeitig eine Fassade nach außen aufrecht erhalten zu können, die nach unkritischem Mitmachen aussah.
Unabhängig von der politischen Einstellung kam für Frauen die Doppelbelastung dazu, sich neben der täglichen Arbeit auch um Familie und Haushalt zu kümmern. Entgegen der öffentlich propagierten Gleichstellung änderte sich der gesellschaftliche Umgang mit dem klassischen Familienbild kaum. Frauen wurde nach wie vor die häusliche Domäne zugewiesen, abseits vom Arbeitsplatz hatten Männer das Sagen. Letztlich spiegelte sich das auch in der Führungsspitze der SED in der Frauen keine Rolle spielten.
Transparenz
Vollversorgung der Kinder – Alles gut?
Der Grundtext macht deutlich, dass die Vollversorgung der Kinder nicht von allen Eltern gut geheißen wurde: Dazu werden Kritikpunkte dargestellt, etwa das Primat der Erziehung zur sozialistischen Persönlichkeit, der Stress, der insbesondere auf den Schultern der Vollzeit arbeitenden Frauen lastete, oder die Einschränkungen des Rechts auf eine Berufsausbildung.
Die Materialien in der Materialspalte, Zeitzeugenaussagen von drei Kritikern der „Vollversorgung“, wurden wegen der unterschiedlichen Perspektiven gewählt, die dort vertreten werden.
- Rainer Eppelmann, Vater, Pastor, Bürgerrechtler, betont, dass er darunter gelitten hat, dass den Kindern eine selbstbestimmte Zukunft verwehrt wurde.
- Anna Kaminsky Mutter, Historikerin, heute Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, schildert dass sie als junge Mutter ihren Sohn nicht in die Kita gegeben hat und berichtet somit von einem selten genutzten Spielraum.
- Petra Brückner, Mutter, Ärztin, erzählt, dass die Erfahrungen mit der Kindergartenerziehung ihrer Kinder ein Grund zum Vauserlassen der DDR gewesen seien.
Das Glück der Kinder am Herzen: Gibt es für Eltern Wege aus dem Dilemma?
Ganz vereinzelt versuchten Eltern, „westliche“ Konzepte der Kinderbetreuung zu adaptieren und im Freundeskreis alternative Betreuungsstrukturen für die Kinder anzubieten.
Häufiger bemühten sich Eltern, im privaten Raum für Möglichkeiten individueller Entwicklung der Kinder zu sorgen. Das führte allerdings unweigerlich dazu, dass die Kinder zwischen voneinander abweichenden familiären und gesellschaftlichen Normen unterscheiden mussten. Mit diesem Konflikt mussten Eltern leben, die versuchten, Wege aus dem Dilemma der staatlich gelenkten Kindererziehung zu finden.
Transparenz
Das Glück der Kinder am Herzen: Gibt es für Eltern Wege aus dem Dilemma?
Im Zentrum stehen Bemühungen von Familien, ihre Kindern Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Der Ostberliner „Kinderladen“ stellt hierbei einen Ausnahmefall dar. Häufiger wurde innerhalb der Familien versucht, mit der Erziehung zuhause einen Gegenpol zur staatlichen Erziehung zu schaffen und im privaten Raum für Möglichkeiten individueller Entwicklung der Kinder zu sorgen. Das führte allerdings unweigerlich dazu, dass die Kinder zwischen voneinander abweichenden familiären und gesellschaftlichen Normen unterscheiden mussten.
Die Materialien in der Materialspalte illustrieren und vertiefen (Foto Kinderladen und Literaturbericht über den Kinderladen) bzw. wechseln die Perspektive auf eine Kindheitserinnerung aus einer Pastorenfamilie (Christine Lieberknecht, heute selbst Pastorin und Politikerin)
Wie können Bildungsoptionen zu einem Machtinstrument des Staates werden?
Sich der staatlichen Sorge um den Nachwuchs zu verweigern war kaum möglich. Dies galt nicht nur für die Vorschulerziehung und die Schule, sondern auch für den eng mit Schule verwobenen außerschulischen Bereich. Hier wirkte der – oft implizite – Teilnahmezwang.
Wer nicht Mitglied in den Massenorganisationen der SED war, dem verwehrte der Staat Chancen für individuellen Wohl-Stand.
Für Kinder fing das schon in der Schule an. Wer nicht bei den Jungen Pionieren war und dann der FDJ beitrat, konnte z.B. meist nicht auf die Zulassung zum Abitur hoffen. Spätestens mit dem Eintritt ins Berufsleben waren weitere Mitgliedschaften in staatlichen Massenorganisationen dann unausgesprochene Pflicht.
Transparenz
Wie können Bildungsoptionen zu einem Machtinstrument des Staates werden?
Die vielfältigen Formen des impliziten Teilnahmezwangs im Schulalter wie im Berufsleben und die Möglichkeit einer Diktatur, repressive Maßnahmen in Bezug auf Bildungs- und Berufskarrieren einzusetzen, stehen in dieser Sektion im Zentrum.
Die Materialspalte verdeutlicht dies am Beispiel „Zulassung zum Abitur“ (nur insgesamt ca. 15 % der Schüler*innen machten im Arbeiter- und Bauernstand DDR das Abitur). Der Weg dorthin hing nicht nur von Leistung, Familie (Arbeiterkinder sollten bevorzugt gefördert werden), sondern auch von gezeigten Überzeugungen ab. Zeitzeugenaussagen (Videographie und Text) konkretisieren. Alternative Wege zu einem Theologiestudium schildert der Pastor, Bürgerrechtler und Politiker Markus Meckel.
Mit den folgenden Unterthemen wollen wir dich dazu anregen, dich näher mit den Markern für sozialen, materiellen und ökologischen Wohlstand in Diktaturen zu befassen.
Du sollst einen Blick dafür bekommen, dass die DDR ihren Bürger*innen ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden grundsätzlich verwehrte, dass jeder einzelne Mensch dennoch in seinem konkreten Leben erfüllt leben konnte.
Ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden verwehrt ein Staat seinen Bürger*innen, indem er Grundrechte missachtet und Träume verwehrt. Bürger*innen können sich ihre Wünsche nicht erfüllen – nicht, weil es nicht möglich wäre, sondern weil der Staat es nicht zulässt.
Wir haben eine Auswahl an Kapiteln getroffen, die besonders gut zu deiner Profilauswahl passen, die du am Anfang gemacht hast.
Du kannst jederzeit gerne nach unten scrollen und dir die übrigen Kapitel des Themas ansehen.
Das Abschlusskapitel solltest du aber auf keinen Fall verpassen, weil es die einzelnen Aspekte des Themas noch einmal zusammenfasst.