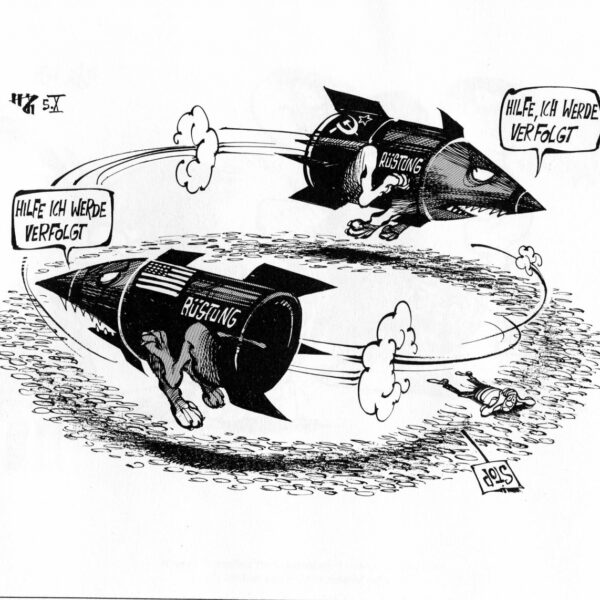Mangelnder Wohlstand
Gelenkte Wege in ein erfülltes Berufsleben?
Privatwirtschaft passt nicht ins System: LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften) und VBEs (Volkseigene Betriebe)
Warum greift der SED-Staat überhaupt in das Berufsleben ein?
Im Arbeiter- und Bauernstaat DDR war das Berufsleben eingebunden in die Staatsideologie, die u.a. das Recht auf und die Pflicht zur Arbeit umfasste. Beides war untrennbar mit dem Wirtschaftssystem der Planwirtschaft verbunden. Privates Unternehmertum hatte in diesem System keinen Platz; Verstaatlichung und Enteignungen waren logische Konsequenzen.
Die staatlichen Betriebe waren in der DDR nicht nur Arbeitsstätten, sondern zugleich „soziale Orte“, die weit über die berufliche Tätigkeit hinaus Bedeutung für das Leben der dort Arbeitenden hatten und nicht zuletzt einen Beitrag zur Entwicklung der „sozialistischen Persönlichkeit“ leisten sollten.
Im Folgenden werden einige Aspekte aufgezeigt, die sich aus diesem ideologisch gebundenen Verständnis von Arbeit für die materielle, soziale und ökologische Dimension von Wohl-Stand der Arbeitenden ergeben.
Ob man die streng regulierte Arbeit in den Staatsbetrieben für sich als eine Form des Wohl-Stands empfand, hing sehr vom Einzelnen ab, von den individuellen Vorerfahrungen, davon, was man vom Leben erwartet, aber auch von anderen Erfahrungen, die man mit dem Leben in einer Diktatur gemacht hatte.
Transparenz
Im Arbeiter und Bauernstaat der DDR war das Berufsleben eingebunden in die Staatsideologie, die auch das Recht auf und die Pflicht zur Arbeit umfasste.
Warum greift der SED-Staat überhaupt in das Berufsleben ein?
Das Ziel dieser Sektion ist die Einordnung in größere Zusammenhänge. Herausgearbeitet wird zudem, dass das Berufsleben Bedeutung für das Wohl-Befinden und damit den Wohl-Stand eines Lebens hat. Die Sektion ist so angelegt, dass der Widerspruch zwischen sozialistischer Planwirtschaft und echtem sich-Wohl-Fühlen sichtbar wird, zwischen individuellen Nischen des Zufriedenseins und den Rahmenbedingungen, die diese Nischen erst nötig machten bzw. schufen.
Die Materialspalte unterteilt sich in zwei Blöcke:
- Der erste Block behandelt die LPGs und die Industrialisierung der Landwirtschaft, zu deren Zweck die landwirtschaftlichen Betriebe enteignet wurden. Angesprochen werden zum einen die Probleme, die daraus erwuchsen (Zeitzeugeninterview eines Schlossers bei einer LPG). Zum anderen wurde bewusst auch ein Material gewählt, das zeigt, dass Menschen, die gern in Landwirtschaften arbeiteten, sich in ihrer LPG wohlfühlten. Dieser Interviewauszug verdeutlicht, dass der Blick für die gößeren politischen Kontexte schwer fiel. Darauf deutet eine sehr grundsätzliche, reale Gegebenheit weitgehend ausblendende Kritik an der Treuhand hin. In weiteren Materialien wird die propagandistische Überhöhung der „Ernteeinsätze“ u.a. von Studierenden, durch die SED dargestellt.
- Der zweite Block der Materialien thematisiert VEB: Hier wird nach der Darstellung der wiederum enteignungsbedingten Größe der Betriebe, die Überwachung durch die Stasi angesprochen.
Historischer Kontext
Zu einem zufriedenen Leben gehört auch, dass man sich in seinem Beruf und am Arbeitsplatz wohl fühlt. Das gilt grundsätzlich in jedem gesellschaftlich-politischen System. Die Tätigkeit an sich und die Kollegen außen herum bilden einen Mikrokosmos in dem man sich zurechtfinden können muss. Klappt das nicht könnte man den Arbeitsplatz oder gleich den Beruf wechseln. Das war in der DDR so nicht vorgesehen und in der Regel blieb man dort, wo man einmal zu arbeiten angefangen hatte.
Der Staat beeinflusste von Anfang an die Berufswahl wie die Berufsausübung. Neben planwirtschaftlichen Bedarfsberechnungen, war die politische Loyalität dem SED-Staat gegenüber von Bedeutung. Die konkreten Erfahrungen der DDR-Bürger*innen mit Beruf und Arbeit (und die Erinnerungen daran) sind weit gestreut. Sie spiegeln sehr unterschiedliche Maße an Lebenszufriedenheit wider; der Zusammenhang Erfahrung – Rahmenbedingungen wird dabei je nach Erzählung berücksichtigt oder auch nicht.
Zeitzeugen Erfahrungen
Zeitzeugen Erfahrungen
Freie Berufswahl – in einer Planwirtschaft?
In einem Beruf zu arbeiten, den man selbst gewählt hat und mag, ist ein wichtiges Kriterium für Wohl-Stand. Der Berufswahl und der Möglichkeit, zwischen verschiedenen Berufen zu wechseln, kommt deshalb große Bedeutung zu.
In der DDR füllten alle Schüler*innen in der Mittelstufe eine „Bewerberkarte“ aus. Man musste sich dabei für einen Beruf aus der Liste der planwirtschaftlich benötigten Berufe entscheiden. Das Angebot unterschied sich je nach Region und Bedarf. Pro Person konnte außerdem nur genau eine Bewerbung abgegeben werden. Um die zur Wahl stehenden Berufe kennenzulernen, wurden den Jugendlichen eine ganze Reihe von Möglichkeiten angeboten (Betriebsbesichtigungen, Beratungsgespräche, Informationstermine usw.).
Gab es mehr Bewerber*innen als Angebote, erfolgten Auswahl und Umverteilung der Bewerber*innen. Die Kriterien, die dabei zur Anwendung kamen, wurden nicht offengelegt. Klar war lediglich: Binnen sechs Wochen mussten die Lehrverträge unterschrieben sein. Fanden Jugendliche keinen Beruf, für den sie sich begeistern konnten, mussten sie nehmen, was verfügbar war.
Links zum Thema
Transparenz
Freie Berufswahl – in einer Planwirtschaft?
Diese Sektion behandelt den ganz grundsätzlichen Widerspruch zwischen Planwirtschaft und der Freiheit des Einzelnen, den Beruf zu wählen, in dem er/sie für sich ein Wohl-fühlen realisiert sah. Vorgestellt wird das System der „Bewerberkarte“, mit der jede/r Schüler*in genau eine Möglichkeit bekam, den eigenen Berufswunsch zu äußern. Die Berufe, die zur Wahl standen, ergaben sich aus den jeweiligen planwirtschaftlichen Bedarfen. Zugleich wird gezeigt, dass innerhalb dieses Rahmens eine ganze Reihe von betriebserkundenden Möglichkeiten geschaffen wurden, Betrieb und Beruf und deren Rollen im sozialistischen Staat kennen zu lernen (Betriebsbesichtigungen, Beratungsgespräche, Informationstermine usw.).
In der Materialspalte wird zum einen das Bewerbungsverfahren näher erläutert. Zum anderen werden durch Zeitzeugen-Aussagen Konsequenzen aus den Zwängen der Planwirtschaft verdeutlicht. Eine Zeitzeugin beschreibt, dass sie einen Beruf erlernen musste, den sie nicht wollte, ein anderer beschreibt die mit dem Abitur verbundene Berufsausbildung als Steuerungsmaßnahme des Staates. Ein dritter Zeitzeuge schildert, wie der SED-Staat, sobald bei einer Person Mängel in der sozialistische Gesinnung vermutet wurden, in Berufskarrieren eingriff.
Die „Arbeitsbrigade“ strukturierte das Arbeitsleben in der DDR. Egal in welcher Branche, alle Arbeitenden gehören in ihrem Betrieb einer „Brigade“ an. Eine Leitungsperson, der „Brigadier“, übernahm dabei die Gruppenführung.
Betriebs-Brigaden – Ort des Wohlfühlens?
„Brigaden“ bzw. die „Kollektive der sozialistischen Arbeit“ waren Gruppen von ca. zehn Personen, die im Arbeitsablauf eng zusammenarbeiteten. Geleitet wurden sie von „Brigadiers“. Diese hatten einerseits arbeitsorganisatorische Aufgaben wie Arbeitsverteilung oder Leistungserfassung.
Sie wirkten andererseits bei der Prämienverteilung mit oder bei der Verteilung von Unterkünften für den Urlaub. Durch ihr Vorbild sollten sie ihre Gruppen auch zu einer sozialistischen Erziehungs- und Lebensgemeinschaft machen.
Im Brigaden-Alltag der Brigaden gab es Einiges, dem die Mehrheit ihrer Mitglieder distanziert bis ablehnend gegenüberstand, dies galt insbesondere für die erlebten Zwänge und teils lästigen Pflichtaufgaben. Anderes fand dagegen ihre Wertschätzung: Mitglieder der Kollektive unterstützten sich gegenseitig, etwa bei der Beschaffung von „Mangelware“, bei der Wohnungsrenovierung oder bei der Kinderbetreuung.
Transparenz
Betriebs-Brigaden – Ort des Wohlfühlens?
In dieser Sektion wird das Brigadensystem als die betrieblich Variante des „Kollektivs“ erläutert sowie die Rolle des Brigadiers, wobei darauf geachtet wird, auch zu erklären, worauf positive Rückerinnerungen fußen können. Die Erinnerung an Zusammenhalt und Gemeinschaft überdecken häufig die erlebten Zwänge und „lästigen Pflichtaufgaben“. Zugleich werden wiederum Hintergründe und Zusammenhänge mit SED-Staat und Kontrolle dargestellt.
Die Materialspalte hebt die Bedeutung von Brigaden/ Kollektiven für den SED-Staat hervor (gestellte Fotos funktionierender Brigaden, Auszüge aus einer Doku, Zeitzeugen-Erinnerungen).
Prämien für Kollektive – belebt der sozialistische Wettbewerb das Geschäft?
„Sozialistisch arbeiten, leben, lernen“ stand auf der Auszeichnung als „Kollektiv der sozialistischen Arbeit“. Sie wurde an Betriebskollektive, aber auch an Teams aus Wirtschaft, Lehre, Kunst, Kultur, Militär für die Erfüllung des Plansolls und weiterer politischer, kultureller und fachlicher Anforderungen verliehen. Durch die Konkurrenz mit anderen Teams sollte man motiviert werden, mehr Leistung zu erbringen. Man nannte das „sozialistischen Wettbewerb“.
Der Nachweis der Leistung wurde durch das Brigadetagebuch erbracht. Dort wurde z.B. der gemeinsame Kino- oder Theaterbesuch beschrieben, aber auch freiwillige Arbeitseinsätze, die Teilnahme an sozialistischen Feiern oder die Teilnahme an Wahlen.
Wurde der Titel erworben, bekam das gesamte Team gemeinsam eine Prämie, die auch gemeinsam ausgegeben werden musste, z.B. bei ausgelassenen Brigadefeiern.
Transparenz
Prämien für Kollektive – belebt der sozialistische Wettbewerb das Geschäft?
Die Auszeichnung für Kollektive für die Erfüllung des Plansolls und weiterer politischer, kultureller und fachlicher Anforderungen gehörte zum System: Prämien sollten motivieren, mehr Leistung zu erbringen. Sie wurden entweder an Einzelne oder, wie im geschilderten Beispiel, an das gesamten Kollektiv ausgezahlt. Als Grundlage für Brigadeauszeichnungen diente das Brigadetagebuch. Dieses konnte zugleich von der Stasi als eine ihrer vielen Infoquellen genutzt werden.
Die Materialien in der Materialspalte verdeutlichen das Prämiensystem. Das Brigadetagebuch diente für dieses Prämiensystem als Dokumentationsgrundlage.
Mit den folgenden Unterthemen wollen wir dich dazu anregen, dich näher mit den Markern für sozialen, materiellen und ökologischen Wohlstand in Diktaturen zu befassen.
Du sollst einen Blick dafür bekommen, dass die DDR ihren Bürger*innen ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden grundsätzlich verwehrte, dass jeder einzelne Mensch dennoch in seinem konkreten Leben erfüllt leben konnte.
Ein tiefes, gesichertes Wohlbefinden verwehrt ein Staat seinen Bürger*innen, indem er Grundrechte missachtet und Träume verwehrt. Bürger*innen können sich ihre Wünsche nicht erfüllen – nicht, weil es nicht möglich wäre, sondern weil der Staat es nicht zulässt.
Wir haben eine Auswahl an Kapiteln getroffen, die besonders gut zu deiner Profilauswahl passen, die du am Anfang gemacht hast.
Du kannst jederzeit gerne nach unten scrollen und dir die übrigen Kapitel des Themas ansehen.
Das Abschlusskapitel solltest du aber auf keinen Fall verpassen, weil es die einzelnen Aspekte des Themas noch einmal zusammenfasst.