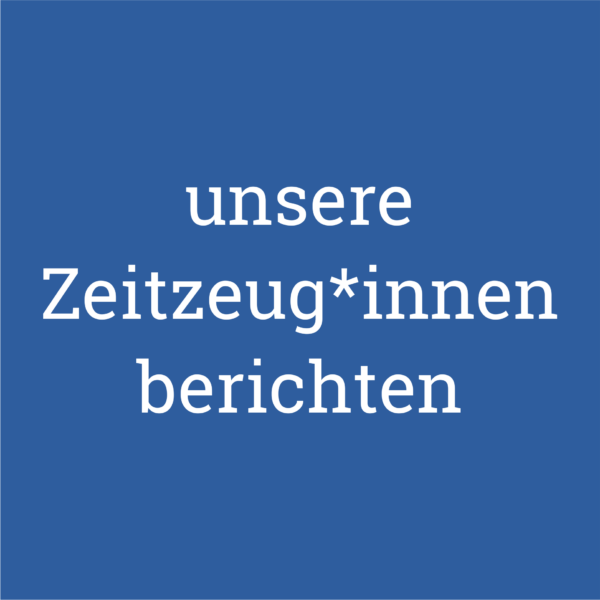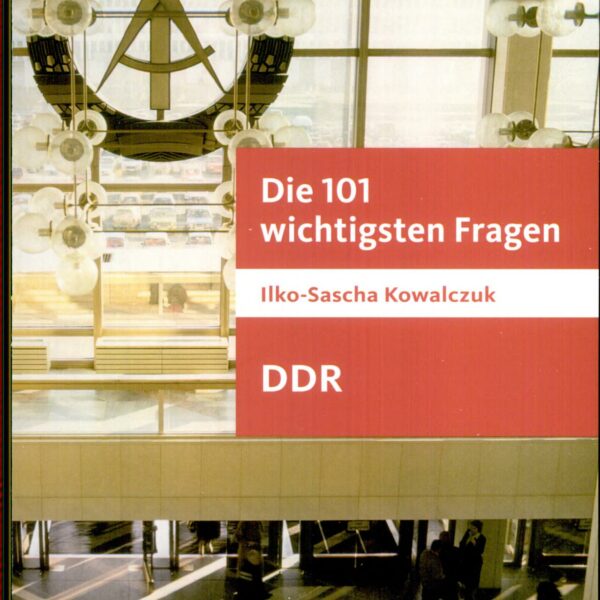Inhaltselement
Heiße Themen beziehen sich auf unsere Themenfelder und die dort erschlossenen Unterthemen. Sie greifen Aspekte daraus auf, die in aktuellen Debatten diskutiert werden. Oft geht es um problematische Vergangenheitsdeutungen oder um politische Instrumentalisierungen. Es kann sich aber auch um Themen handeln, die individuelle DDR-Erfahrungen unbedacht generalisieren. Zum Teil werden Aspekte der DDR-Geschichte neu kontextualisiert und neu interpretiert. Hier kannst du gut nachvollziehen, dass Geschichte nicht vergangen ist, solange man darüber spricht.
Historischer Kontext
Transparenz
Heiße Themen
Weitere Materialien
Multiperspektive
Gedenkstätten
Heiße Themen, die uns auch heute angehen und beschäftigen
Die Vergangenheit ist zwar vergangen, aber sie wirkt noch immer in unsere Gegenwart hinein. Wir erzählen Geschichten über die Vergangenheit und Geschichten transportieren Ideen und Meinungen. Darum ist es wichtig, sich eine eigene Meinung über vergangene Ereignisse und Zusammenhänge zu bilden, um mit den Meinungen anderer umgehen zu können.
Wir wollen anregen, sich mit Gemeinsamkeiten, die in allen Staatsformen und Gesellschaftssystemen gelten, zu befassen und sie genauer unter die Lupe zu nehmen.
Wir haben Urteile und Einschätzungen ausgewählt, mit denen auch du konfrontiert werden könntest.
In Bezug auf die Argumentation stellen wir die Frage,
„was geht“ – und „was geht gar nicht„?
Transparenz
Gesellschaften sind komplexe Systeme. Die eine Wahrheit und das einzige richtig oder falsch gibt es nicht.
Es kommt darauf an, worauf man sich in einer Gesellschaft einigen kann. Regeln und Gesetze sind nicht vom Himmel gefallen oder schon immer da. Sie entstehen im Lauf der Zeit und stellen dar, worauf man sich einigen konnte.
Genauso ist es mit impliziten Regeln und mit Normen. Was ist gut, was ist schlecht? Was kann man tun und was darf man nicht?
Nur weil etwas nicht verboten ist, heißt das nicht, dass einem die Nachbarn und die anderen Mitmenschen Beifall klatschen, wenn man es tut. Vielmehr ist es so, dass wir uns gegenseitig maßregeln. Das tut jeder Mensch, auch du und ich. Jedes mal, wenn man jemandem widerspricht und seine eigenen Meinung sagt, versucht man denjenigen in die „richtigen“ Bahnen zu lenken und empfundenes Fehlverhalten zu korrigieren.
Das bedeutet aber auch, dass man eine Verantwortung dafür hat, dass die eigene Sicht der Dinge stimmig und gut begründet ist. Man kann leicht für oder gegen etwas sein, wenn man eigentlich keine Ahnung hat.
Darum ist es wichtig, sich mit den Argumenten und Meinungen anderer auseinanderzusetzen, um selbst in der Lage zu sein, fundierte Gegenargumente liefern zu können, wenn das erforderlich ist. Gesellschaft funktioniert nur, wenn wir alle mitmachen.
Wir haben Themen ausgewählt,
- bei denen sich Ost- und West-Sichten unterscheiden, bei denen Entwicklungen und Veränderungen unterschiedlich wahrgenommen und beurteilt werden
oder
- Themen, bei denen maßgebliche Unterschiede zwischen Diktatur-Demokratie nicht beachtet werden
Befehl ist Befehl! Gehorsam muss sein! – Wirklich?
Polizist*innen sollen für „Recht und Ordnung“ sorgen. Das ist in allen Staaten so. Polizeikräfte sind ausführendes Organ staatlicher Machtausübung.
Aber bedeutet das auch, dass alle Polizist*innen gleich sind?
Befolgen sie alle dieselben Befehle auf dieselbe Weise?
Historischer Kontext
Wie Polizist*innen handeln und welche Rahmenbedingungen sie zu berücksichtigen haben, hängt stark von den Vorgaben der Polizeibehörden ab. Gibt es eine Regel, die den Einsatz übermäßiger Gewalt verbietet, werden Vorgesetzte und Kolleg*innen eher gegen Verstöße vorgehen. Gibt es stattdessen die Order, dass mit äußerster Härte gegen Abweichler vorgegangen werden muss, werden sich die Polizist*innen entsprechend verhalten.
Auch Strukturen spielen eine Rolle. Gibt es eine Möglichkeit Beschwerden einzulegen? Decken sich die Kolleg*innen gegenseitig oder gibt es eine unabhängige Abteilung, die gegen Verstöße ermittelt? Welche Konsequenzen ziehen Handlungen nach sich?
Alles das beeinflusst die Möglichkeiten von Polizist*innen sich zu verhalten. Letztendlich wird damit festgelegt, wie sich Polizeikräfte gegenüber den Bürger*innen verhalten werden.
Heiße Themen
Das Thema „Polizeigewalt“ wird seit einigen Jahren stark diskutiert.
Es geht dabei darum, dass Polizeikräfte Vertreter und Täter eines unterdrückerischen Systems seien.
Beispiele tödlich verlaufener Polizeieinsätze liefern den Zündstoff für diese Debatte, die mitunter sehr hitzig diskutiert wird.
- Wie geht man damit um?
- Sind die Taten Einzelner Täter*innen, Symptom eines generellen Problems?
- Gibt es den „Polizeistaat“, in dem Polizeikräfte machen können was sie wollen wirklich?
Polizist*innen werden auch selbst immer wieder mit Gewalt konfrontiert. Übergriffe gegenüber Uniformierten, egal ob Polizei oder Rettungsdienst, finden regelmäßig statt und waren nie so häufig wie in letzter Zeit. Das geht aus Statistiken und Untersuchungen hervor.
Polizei muss mitunter Gewalt einsetzen, um sich zu wehren, oder um gefährliche Situationen zu entschärfen. Hat man es mit einem bewaffneten Menschen zu tun, kann man sich nicht immer gut überlegen was man tun könnte. Manchmal eskalieren solche Situationen.
- Wie gehen wir damit um, wenn jemand bei einem Polizeieinsatz stirbt?
- Haben wir es automatisch mit einem Mord zu tun?
- Welche Handlungsspielräume hatte es in der Situation gegeben?
- Wer kann das beurteilen, was geschehen ist?
- Welche Informationen haben wir über den Vorgang?
Polizei kann praktisch sein, wenn etwa gestohlenes wiederbeschafft wird oder wir anderweitig Hilfe brauchen. Polizei kann lästig sein, wenn man selbst betroffen ist und etwa kontrolliert wird, oder sogar verhaftet.
Wie gehen wir mit diesem offensichtlichen Spannungsverhältnis um?
Diese Frage muss diskutiert werden.
Sich zu Beurteilungen anderer verhalten – eine wichtige Aufgabe für uns alle, auch für dich
Die Vielzahl verschiedener Perspektiven, die es zu jedem Thema gibt, macht es nötig, dass wir uns selbst eine Meinung bilden.
Dazu müssen wir kritisch denken und genau darauf achten, was behauptet und gesagt wird.
- Kann ich das Gesagte überprüfen?
- Ist die Argumentation schlüssig und nachvollziehbar?
- Gibt es Widersprüche in der Erzählung oder widerspricht sie dem was anderswo zu lesen ist?
- Wie vertrauenswürdig erscheint der oder die Urheber*in der Aussagen?
Solche Fragen können helfen eine Aussage anderer zu beurteilen und sich selbst eine Vorstellung von der Verlässlichkeit der Aussagen zu machen.
Multiperspektive
Selbstverständlich liegt Kowalczuk mit seiner Einschätzung nicht völlig falsch. Diese Wahrnehmung der Umstände in der DDR hat es sicherlich gegeben. Rückblickend erscheint gerade sensibilisierten Menschen, die sich mit der Materie auskennen, vieles Dunkel und Düster. Wir wissen, dass die DDR eine Diktatur war und die SED ihre Bevölkerung unterdrückte. Wir neigen dazu, das negative zu sehen und zu betonen.
Gleichzeitig greift Kowalczuks Darstellung aber wohl zu kurz. Die Volkspolizei war etwa bemüht ein positives Bild der Polizisten zu zeichnen. Dabei geht es gar nicht darum, ob diese wirklich freundliche Menschen waren oder nur für Propagandaaufnahmen posierten. Der Film selbst ist ein Beweis, dass versucht wurde ein freundliches Image zu erzeugen. Das widerspricht der Aussage von Kowalczuk.
Wenn man mit Geschichte umgeht, kommt es darauf an abzuwägen. Wahrscheinlichkeiten zu bedenken, die Möglichkeit verschiedener Perspektiven nicht zu vergessen.
Es muss auch positive Erinnerungen an die Beamten in der DDR geben. Schließlich waren einige der Erinnernden selbst welche gewesen. Aber auch andere ehemalige DDR Bürger*innen, wie etwa die Mutter im Filmausschnitt, die vom Polizisten ihre verloren gegangene Tochter übergeben bekommen hatte, können eine positive Erinnerung an DDR-Beamte behalten haben.
- Warum ist das wichtig?
- War die DDR nicht eine Diktatur?
- Warum sollen diese positiven Erinnerungen ins Gewicht fallen?
Wenn wir die DDR verstehen wollen, sind auch diese positiven Erinnerungen wichtig. Sie helfen uns nicht nur dabei die DDR in ihrer Zeit besser einzuschätzen, sondern sie helfen uns besonders dabei zu verstehen, wie Menschen sich heute an die DDR erinnern. Wie kann es sein, dass der da, oder die da sagt, „in der DDR war vieles besser“. Völlig unverständlich, wenn die DDR nur eine düstere Diktatur war in der es allen schlecht ging.
Um zu verstehen, muss man sich ein umfassendes Bild machen. Das heißt nicht, dass man mit allem einverstanden sein muss was man hört und liest.
Kontexte und Kurzschlüsse
Manchmal hört man: Es gibt die eine Wahrheit nicht. – Jeder hat seine eigene Wahrheit.
Heißt das zugleich: Es gibt keine Unwahrheit?
Heißt das, der, der sich ärgert, in der Coronapandemie Masken tragen zu müssen, „ist im Recht“,
- wenn er das Symbol „Judenstern“ nutzt,
- wenn er von einer „Maskendiktatur“ spricht,
- wenn er das „Recht für ein Leben ohne Maske“ als Menschenrecht formuliert?
Heißt das also, Menschen, die in einer wirklichen Diktatur gelebt haben, müssen es ertragen und zulassen, dass andere von Corona-Diktatur, Masken-Diktatur, Klima-Diktatur sprechen?
Welche Rolle spielen die überprüfbaren Fakten bei der Entscheidung, ob etwas geht, oder etwas zu kurz greift und verfälscht?
Transparenz
Von der Verharmlosung der SED-Diktatur einmal abgesehen, die für sich schon ein guter Streitpunkt ist, stößt die Verwendung des „Judensterns“ in ganz andere Dimensionen vor. Die Botschaft lautet, „wir werden genauso verfolgt, wie die Juden unter Hitler“.
Sieht man sich das Argument näher an, muss man sich die folgende Frage stellen:
Ist das tragen müssen einer Maske mit dem millionenfachen Mord an Menschen vergleichbar?
Sieht man sich dazu die Konsequenzen an, die ein Verstoß gegen die Maskenpflicht mit sich brachte, stellt man fest, dass es sich dabei um ein Bußgeld handelte, das in Bayern mit 250€ beziffert war.
Vergleichend kann man also feststellen, dass die Selbstassoziation mit der Judenverfolgung im „Dritten Reich“ im besten Falle maßlos übertrieben ist. Mittlerweile zieht dieser Vergleich auch juristische Konsequenzen nach sich, weil er von den meisten Gerichten als Volksverhetzung ausgelegt wird, der die Verbrechen der Nazis verharmlose.
Weitere Materialien
Hier findest du den ganzen Beitrag aus der Jüdische Allgemeine Zeitung.
Nostalgie und Banalisierung
Wer kennt sie nicht, die gute alte Zeit? Nostalgie, also die wehmütige Erinnerung an vergangene Zeiten, in denen alles besser gewesen wäre als heute ist ein menschliches Phänomen. Gerade die Älteren unter uns, werden sich an ihre Jugend erinnern, als das Kreuz noch nicht so wehtat und man noch fitter war. Irgendwann erwischt es jeden.
Es gibt aber feine Unterschiede. Nicht jede Erinnerung ist harmlose Schwärmerei. Gerade nostalgische Erinnerungen an die DDR sind oft verharmlosend, ignorieren die Diktatur und die Unterdrückung. Das hat Auswirkungen darauf, wie wir innerhalb der Gesellschaft an die DDR denken. „Es war nicht alles schlecht“, darf nicht heißen, „eigentlich war alles ziemlich gut“.
Diesen Eindruck vermittelt beispielsweise die NVA-Feldsuppe.
Dass die NVA, das Militär der DDR war und in dieser Rolle nicht nur das System gestützt, sondern auch die Bewachung der Grenze organisiert und durchgeführt hatte, wird ignoriert. So wird aus der harmlosen Suppe ein verharmlosender Streitpunkt.
Historischer Kontext
Anders als bei Produkten, die es früher schon gab und die man deshalb in guter Erinnerung behalten konnte geht es hier lediglich um die Assoziationen, die durch die Produktverpackung aufgerufen werden. Eine einheitliche DDR-Schulsuppe gab es genauso wenig, wie eine NVA-Suppe, die überall gleich gewesen wäre. Die neuen DDR-Suppen sollen stattdessen die „Marke“ DDR nutzen, um bei dafür zugänglichen Zielgruppen ein Kaufinteresse zu erregen. Mit anderen Worten, es geht ums Geschäft. Mit der Geschichte der DDR hat das nur die Begriffe und Assoziationen gemeinsam.
Transparenz
Die „DDR-Suppen“ sind gerade ein viel diskutiertes Thema.
Heiße Themen
NVA-Feldsuppe. Also Suppe der Nationalen Volksarmee. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen.
Was würdest du sagen, wenn jemand eine Bundeswehr Suppe zum Verkauf anbietet?
Zusätzliches Material
Eine interessante und ausgewogene Herangehensweise an das Thema bietet der YouTube Kanal „das Bodenpersonal“ des Bistums Osnabrück: